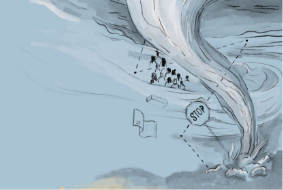Wie aus einem alten Haus neuer Baustoff wird
Aus einem Haus, dessen Bau Monate gedauert hat, wird innerhalb eines einzigen Tages Bauschutt. Doch aus dem Abfall kann Neues entstehen. Wie das geht, haben wir bei einem Recyclingunternehmen verfolgt.
Leichte Nebelschwaden ziehen über den Platz. Es rauscht. Eine Staubwolke entsteht. Sofort springt die Sprinkleranlage an, die Wasser zerstäubt und die Staubwolke bindet. Ein LKW-Sattelzug entlädt. Ringsherum: riesige Schuttberge. Maschinen rumoren, hin und wieder ertönen Warnsignale. Das sind Alltagsgeräusche an dem Standort der REMEX Bochum GmbH, einem Mineralstoff- und Recyclingunternehmen, Tochtergesellschaft der REMEX GmbH und Teil der REMONDIS-Gruppe.
„Unser Kerngeschäft hier am Standort in Bochum, einem reinen Bauschutthauptwerk, ist die Aufbereitung mineralischer Abfälle aus Bauwirtschaft und Industrie“, sagt Geschäftsführer Sven Engler beim Betreten der Halle – drei Etagen, ein über 10.000 Quadratmeter großes Gelände. Wir laufen in gekennzeichneten Sicherheitsbereichen. Ein Förderband verläuft von einem Ende der Halle zum anderen. Große und kleine Schrotte, fein säuberlich sortiert, liegen in einem Nebenraum. Eine Sicherheitshupe ertönt, während ein Radlader vorbeifährt und Schüttgüter für den Abtransport vorbereitet. Normalerweise ist es so laut, dass Engler schreien müsste. Ein Gehörschutz ist hier Pflicht. Für den Rundgang wird der Regelbetrieb kurzzeitig unterbrochen.

„Das war heute Morgen noch ein
Bungalow in Bochum-Wattenscheid.”– Sven Engler, Geschäftsführer der REMEX Bochum GmbH

„Wird ein Gebäude abgebrochen, fällt jede Menge Bauschutt an. Allein hier an unserem Standort empfangen wir pro Jahr etwa 200.000 Tonnen an Eingangsmaterial.“ Doch was steckt da eigentlich drin? Wie wird aus einem ehemaligen Bungalow in Bochum- Wattenscheid binnen Minuten ein genormter Recycling-Baustoff, Korngröße 0/45 mm? „Auf der Baustelle ist natürlich vorher schon einiges passiert“, sagt Engler, als wir zur Eingangspforte laufen. Bevor ein Recycling-Baustoff hergestellt werden kann, muss ein Gebäude selektiv zurückgebaut werden. Der Bauschutt, der vor Ort anfällt, wird entweder vor Ort gebrochen und gesiebt oder unmittelbar per LKW zum Recyclinghof gebracht, eingelagert oder sofort weiterverarbeitet. „Herzstück unseres Betriebsablaufs ist die Annahme. Der Bauschutt, den wir als Eingangsmaterial entgegennehmen, besteht hauptsächlich aus Beton, Klinkern, Ziegeln, Asphalt beziehungsweise Straßenaufbruch, Kies und Sand. Die Fahrzeuge werden hier mitsamt ihrer Ladung gewogen.“ Engler zeigt auf ein digitales Display mit allerhand technischen Kennzahlen. Eine Kamera dokumentiert die Draufsicht auf den LKW. Der LKW, der gerade einfährt, wiegt 40 Tonnen. Er kommt direkt aus Bochum, genauer: aus Wattenscheid.

Abgebrochene Gebäude auf LKWs
Die LKWs, die hier ankommen, sind mit Böden
und Bauschutt aus dem Straßen- und Tiefbau
beladen, aber auch mit abgebrochenen alten Gebäuden aus der unmittelbaren Region. „Wir dokumentieren die Abfallkategorie, die Herkunft und eventuelle Vorerkundungen. Im Grunde fungieren die Mitarbeitenden hier als ‚Türsteher‘ für die entsprechenden Eingangsmaterialien.“ Explizit nicht zu den Eingangsmaterialien gehören asbesthaltige Materialien, pech- oder teerhaltiger Straßenaufbruch, gipshaltige Baustoffe oder mineralische Dämmstoffe.
Tagein, tagaus: Sieben, Brechen, Klassieren
Die Reise des Rohstoffs beginnt in einem Aufgabebunker. Das Material wird mittels eines Plattenbandes ins sogenannte Lesehaus zur Sortierung befördert. „Die Sortierung durch unsere Mitarbeiter hilft uns, die möglichen Fremdstoffe vorab zu eliminieren.“ Das Material wird zunächst zerkleinert und gesiebt, ein übliches Verfahren in der Industrie, bei dem Schüttgüter entsprechend ihrer Größe getrennt werden. Bei der sogenannten Siebklassierung erfolgt die Trennung mittels eines Siebbodens mit vielen geometrisch annähernd gleichen Aussparungen. „Das hilft uns bei der Vorsortierung, bei der wir Schad- und Fremdstoffe eliminieren“, sagt Engler mit Blick in den Maschinenraum. Das Fließband rotiert in gleichmäßigem Tempo weiter, bis er es stoppt.
Diese Eingangsmaterialien werden zu Recycling-Baustoffen aufbereitet:
Bauschutt (bestehend z. B. aus Beton, Ziegel, Keramik)
Straßenaufbruch
mineralische Anteile von Baustellenabfällen
bei der Produktion von mineralischen Baustoffen entstandener Bruch oder Fehlchargen
Bodenaushub mit mineralischem Stoffanteil von mehr als 10 Volumenprozent

Blick in die Sortierkabine: Hier werden grobe Störstoffe wie Holz oder Drähte manuell entfernt.
„Den Betriebsablauf unterbrechen wir in der Regel nur, wenn es zu Stör- und Ausfällen kommt oder wenn wir Schadstoffe entdecken, die unser fertiges Endprodukt verunreinigen würden oder eine gesundheitliche Gefahr darstellen.“ Es geht eine steile Treppe hinauf. „Volle Konzentration auf den Gehweg“, mahnt Engler. In dieser Phase des Prozesses sortieren die Betriebsmitarbeitenden im Werk – in der Regel digital gestützt – Metalle, Kunststoffe, Folien, Wurzeln und Holz aus. „Wir sortieren nicht nur aus, wir gewinnen aus den mineralischen Abfällen auch große Mengen an Eisenschrott und anderen wertvollen Metallen, die wir in den Materialkreislauf zurückführen“, verdeutlicht Engler.
Die Anforderungen an das Endprodukt, eine aufbereitete rezyklierte Gesteinskörnung für Beton, ist aufwendig. In regelmäßigen Abständen werden die bautechnischen und umweltrelevanten Eigenschaften im Rahmen der Güteüberwachung der Recycling-Baustoffe überwacht. Die Recycling-Baustoffe werden in unterschiedlichen Sieblinien angeboten und decken damit eine große Palette von Anwendungsgebieten ab, jeder einzelne Prozessschritt wird dokumentiert. Der Bauschutt wird mit einer Bramme zerkleinert. Mit dem Sieb- und Ausleseverfahren werden unterschiedliche Körnungen hergestellt, die in bestimmten Mischungsverhältnissen zu Gesteinskörnungen zusammengeführt werden.

Hier geht nichts verloren. Stahldrähte, Aluminiumprofile und andere wertvolle Rohstoffe werden gesammelt.
Hauptanwendung: Straßen- und Erdbau
Die mengenmäßig bedeutsamsten Anwendungsbereiche liegen im Straßen- und Erdbau. Denn aufgrund seiner guten physikalischen Eigenschaften ist dieser Recycling-Baustoff geeignet für den Einsatz als Frostschutz- oder Schottertragschicht für Straßen aller Belastungsklassen, also auch für anbaufreie Straßen wie Bundesautobahnen oder Landstraßen. Sven Engler schaut zufrieden, als er zum Endpunkt der Maschine geht. Hier rieselt die Gesteinskörnung 0/45 hinab. Er lotst einen Maschinisten, der das Material in einen LKW einlädt. „Die Recycling-Gesteinskörnungen, die wir an unserem Standort herstellen, werden hauptsächlich als Tragschichtmaterial beim Straßenbau oder in Unterbauten von großen Industriebauten eingesetzt. Die Anwendungsgebiete sind vielfältig. Unser 0/45er Ausgangsmaterial dient vor allem als Schottertragschicht.“ Die Reise des Rohstoffs endet hier. Rund 25 Minuten sind vergangen.

Ähnliche Artikel

- Das Thema
Neue Gesichter
Menschen ändern sich, auch die in Unternehmen. Die Generation Z hat sich kaum eingearbeitet, da klopft bald schon die Generation Alpha an die Unternehmenstür. Falls denn jemand klopft. Die Anzahl der Bewerbungen jedenfalls wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter abnehmen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge verlassen im kommenden Jahrzehnt fünf Millionen Menschen mehr den Arbeitsmarkt als in ihn eintreten. Rein quantitativ bedeutet der Fachkräftemangel also, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch die Anforderungen, die mit der Arbeitsstelle verbunden sind, passen immer weniger zu den Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber – Fachkräftemangel ist demnach auch ein qualitatives Problem. Eklatant zeigt sich dies beim Bau: Für 90,3 Prozent der Stellen in der Bauplanung und -überwachung gab es im Januar 2024 laut IW keine entsprechend qualifizierten Arbeitslosen. In der Bauelektrik lag diese so genannte Stellenüberhangsquote bei 81,7, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei 78,1.

- Unterwegs
Der Schlüssel zur Zufriedenheit
An einem Morgen Anfang Mai weist die Job-Suchmaschine „Stepstone“ 124 offene Stellen für die Stadt Espelkamp und einen Umkreis von zehn Kilometern aus. Es fehlen ein Projektleiter für den Automotivebereich, ein Elektroniker für den Sondermaschinenbau, eine Leiterin für die Produktionsplanung und Vertriebslogistik und 121 weitere qualifizierte Arbeitskräfte in der ostwestfälischen Stadt mit rund 25.000 Einwohnern. Laut der Studie „Hidden Champions in Nordrhein- Westfalen“ beheimatete die Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe im Jahr 2021 90 von 960 landesweit identifizierten Unternehmen dieser Art, die in der Regel zu den Top-3-Unternehmen in ihrer Branche auf dem Weltmarkt zählen. Dennoch zieht es vor allem wenige jüngere Fach- und Führungskräfte in den Nordosten von Nordrhein- Westfalen. Zu groß scheint für die meisten das Spannungsfeld von innovativen, zukunftsorientierten und gut bezahlten Jobs auf der einen, aber eher ländlichen Lebens und Versorgungsstrukturen auf der anderen Seite.

- Draufgeschaut
3 neue Kolleginnen und Kollegen
Wenn es schwieriger wird, Fachkräfte für sich zu gewinnen, lohnt sich ein genauerer Blick. Muss ich vielleicht gezielt nach neuen Gesichtern suchen, denen ich zuvor noch keine Aufmerksamkeit geschenkt habe? Wir stellen drei fiktive potenzielle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor, die gewissen Zielgruppen entspringen, allerdings nicht mit ihnen identisch sind. Denn es bleibt dabei: Auch wenn ein Mensch zu einer Zielgruppe gehört, so bleibt er doch ein Individuum mit ganz eigenen Eigenschaften und Wünschen.

- Persönlich
Weshalb unsere Branche Interesse weckt
Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen setzen sich intensiv mit innovativen Wasserlösungen im Quartier auseinander: Im Ruhrgebiet trotzen die kommunalen Wohnungsunternehmen VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum und DOGEWO21 in Dortmund Starkregen und Trockenheit in ihren Wohnquartieren. Von Regenwassertanks bis hin zu grünen Dächern - diese Maßnahmen helfen nicht nur der Umwelt, sondern auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, sorgen für ein besseres Mikroklima und wappnen das Lebensumfeld der Menschen für Extremwetterereignisse. Auch in der „Schwammstadt“ des Verbandsmitglieds VIVAWEST sind Versickerungsflächen für hohe und intensive Niederschlagsmengen ein wichtiger Teil der blauen Infrastruktur und die wassersensible Stadtentwicklung der GEBAG in Duisburg passt das Wohnen an die Gegebenheiten an, die der Klimawandel in Flussnähe am Rhein notwendig macht. In diesem Artikel heißt es: Eintauchen in nachhaltige Wasserprojekte, die Städte widerstandsfähiger, Wohnquartiere lebenswerter und das Klima vor Ort besser machen.