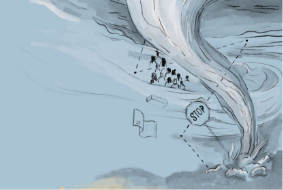Das Bauen mit gebrauchten Materialien zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Es könnte alles so einfach sein: Die Bauherrin bzw. der Bauherr geht in den Laden um die Ecke und kauft alte Türen, Waschbecken, Treppen oder Fliesen, um sie in ihrem Neubau wiederzuverwenden. Nun, um die Ecke befindet sich der Laden noch nicht, mehr als ein Klick ist er aber auch nicht entfernt. Denn einige Anbieter bieten inzwischen gebrauchte Bauteile zur Wiederverwendung an. Gleichzeitig werden mehr und mehr recycelte Gesteine angeboten, um daraus etwa Recyclingbeton herzustellen, bereits einmal verbautes Material wird also auch hier wiederverwendet. Gewissermaßen Bauen Second Hand.
Warum aber sollten Bautätige überhaupt gebrauchte Ware einsetzen? Um sich die Notwendigkeit der Wiederverwendung von Baumaterialien klarzumachen, hilft ein Blick in die Statistik: 53,9 Prozent der Abfälle in Deutschland im Jahr 2021 waren laut Statistischem Bundesamt dem Bausektor zuzuordnen, insgesamt 221,9 Millionen Tonnen. Dabei verursacht jeder Abfall Kosten, wenn er beispielsweise entsorgt und vielleicht irgendwo auf einer Deponie abgelagert werden muss.
Handelt es sich bei dem Abfall um Beton, bleibt zu konstatieren: Sand, der für die Betonherstellung benötigt wird, wächst nicht nach. Man kann nicht beliebig viel von ihm herstellen. Es handelt sich also um eine endliche Ressource, mit der man sparsam umgehen sollte. Auch um das Landschaftsbild nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Bleibt Abfall, ob nun Gestein oder Tür, ungenutzt, bedeutet er zudem auch Verschwendung, weil es sich ja um Material handelt, das einmal gewonnen beziehungsweise unter dem Einsatz von Energie und dem Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) produziert worden ist. Laut Internationaler Energieagentur gehen 38 Prozent des weltweiten Kohlendioxidausstoßes auf den Bau und die Nutzung von Gebäuden zurück. Acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen werden allein durch die Zementherstellung verursacht. Wenn die Bauteile und -stoffe wiederverwendet werden, muss kein neues CO2 ausgestoßen werden, um neues Material zu produzieren.

Beim Bau neuer Gebäude sollte unter dieser Prämisse darauf geachtet werden, dass sie am Ende ihres Lebenszyklus möglichst einfach demontiert werden können, damit die Baustoffe getrennt und wiederverwendet werden können. Die anstrebenswerte Aufgabe besteht darin, die Stoff- und Materialkreisläufe zu erhalten, um ein echtes Recycling ermöglichen zu können, also das Material für exakt denselben Einsatzzweck zu nutzen. Oft ist immerhin noch eine Kaskadennutzung möglich, also der Einsatz des Baustoffes in einer weniger wertigen Form, beispielsweise wenn ein tragendes Holzteil irgendwann einmal als Span in einer Bauplatte endet. Der gängige Begriff dafür ist Downcycling.
Die Wiederverwendung zielt auf die Vermeidung von CO2 und den Schutz der natürlichen Ressourcen ab.
Praktische Stolpersteine
Die Wiederverwendung zielt also auf die Vermeidung von CO2-Ausstoß und den Schutz der natürlichen Ressourcen ab. Soweit der Anspruch in der Theorie. In der Praxis bieten sich Bauherrinnen und Bauherren aber vielerlei Probleme und Stolpersteine.
Zum einen ist die Wiederaufbereitung ein kostenintensiver Prozess, zum anderen müssen Bauteile laut Landesbauordnungen eine Produktzulassung haben und eingebaut werden können. Alte Bauteile müssen also erst einmal zertifiziert werden, und eine geltende Norm zum Wiedereinbau gibt es derzeit noch nicht. Abgesehen davon verwehren nicht selten energetische Vorschriften den Einbau beispielsweise von alten Fenstern, weil diese zu viel Wärme nach außen dringen lassen.
Zusätzlich enthält ein recyceltes Produkt häufig nur einen Anteil an Rezyklat, große Teile der Gesamtzusammensetzung bestehen weiterhin aus neuen Rohstoffen. Produkte, die zu 100 Prozent aus Rezyklat bestehen, sind äußerst selten vorzufinden und auch dann muss noch geprüft werden, ob dieses Produkt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzt.
So wird zwar viel über zirkuläres Bauen gesprochen und geforscht, in der Praxis ist dieses Prinzip aber noch nicht allzu weit verbreitet. Das liegt auch daran, dass noch bei Weitem nicht alle Planungs- und Architekturbüros sich das Thema zu eigen gemacht haben. Und damit fehlt auch die breite Erfahrung mit den Materialien, die von einem Unternehmen an das andere weitergegeben werden könnte. Deshalb spielt zirkuläres Bauen momentan mehr auf Konferenzen als auf realen Baustellen eine Rolle.
Kosten Haupthemmnis?
Da es ein kostenintensives Geschäft zu sein scheint, gebrauchte Waren einzubauen, wird häufig darauf verzichtet. Das Kostenargument aber möchte etwa Petra Riegler-Floors, Professorin für Zirkuläres Bauen an der Hochschule Trier, nicht ohne Weiteres gelten lassen. Im Interview mit „thema“ sagt sie, beim Bau würde zu stark auf die Errichtungskosten geschaut – und zu wenig auf die während des Betriebs und bei bzw. nach Abriss des Gebäudes. Die Entsorgung der Materialien etwa müsse eingepreist werden.
Das Interview mit Prof. Riegler-Floors ist ein zentraler Bestandteil dieser Ausgabe. Ein weiterer ist unsere Reportage von einem Recycling- Hof, wo ehemalige Häuser bzw. deren Gesteinsmaterial so aufbereitet werden, dass sie als Recyclinganteil in neuem Beton eingesetzt werden können.
Momentan sehen Bauherrinnen und Bauherren eher einen Stolperstein nach dem anderen auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft im Bau. Doch die praxisnahen Ansätze gibt es auch. Höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme.
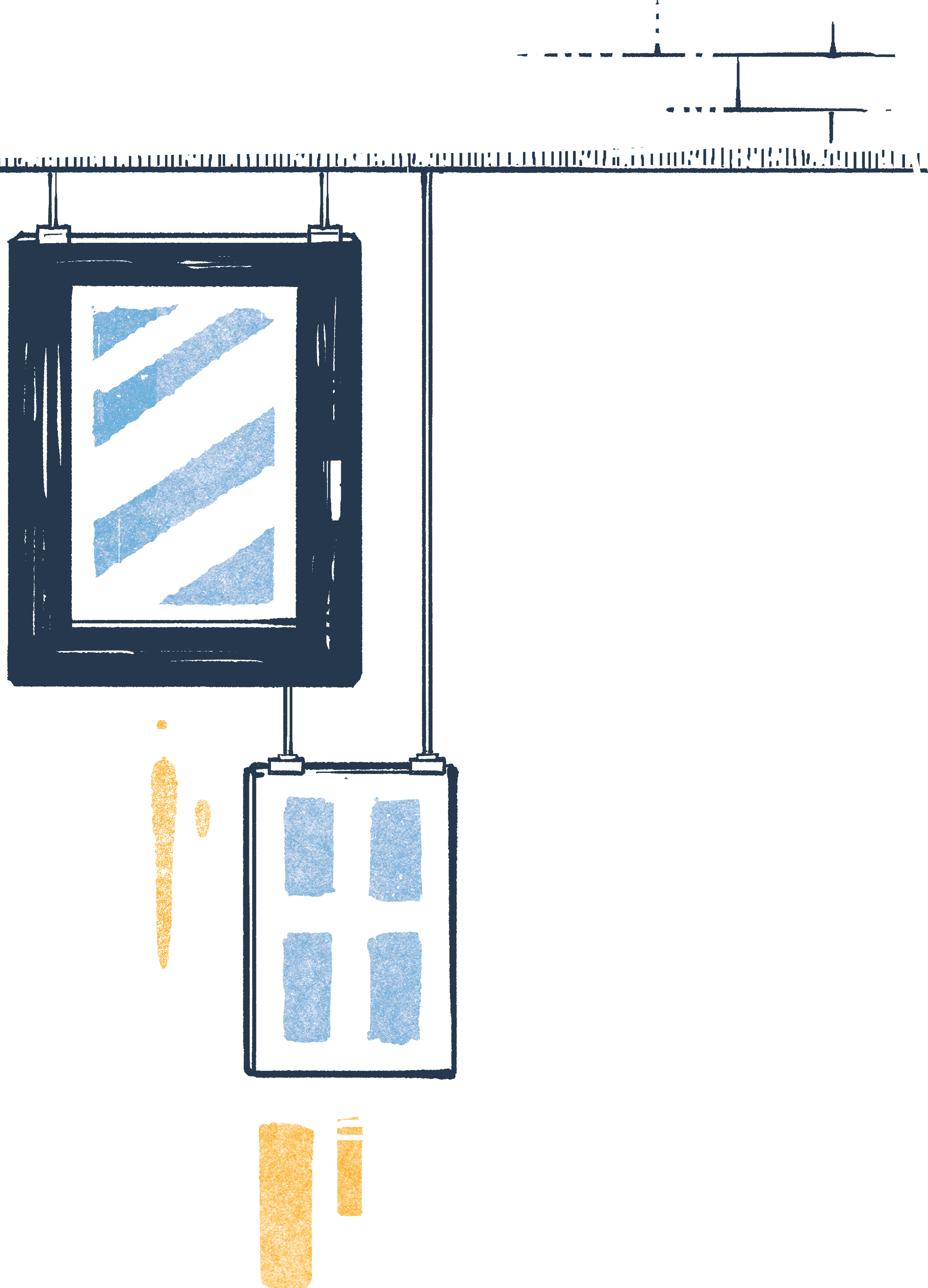
Ähnliche Artikel

- Das Thema
Neue Gesichter
Menschen ändern sich, auch die in Unternehmen. Die Generation Z hat sich kaum eingearbeitet, da klopft bald schon die Generation Alpha an die Unternehmenstür. Falls denn jemand klopft. Die Anzahl der Bewerbungen jedenfalls wird aller Wahrscheinlichkeit nach weiter abnehmen. Dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge verlassen im kommenden Jahrzehnt fünf Millionen Menschen mehr den Arbeitsmarkt als in ihn eintreten. Rein quantitativ bedeutet der Fachkräftemangel also, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen. Aber auch die Anforderungen, die mit der Arbeitsstelle verbunden sind, passen immer weniger zu den Kompetenzen der Bewerberinnen und Bewerber – Fachkräftemangel ist demnach auch ein qualitatives Problem. Eklatant zeigt sich dies beim Bau: Für 90,3 Prozent der Stellen in der Bauplanung und -überwachung gab es im Januar 2024 laut IW keine entsprechend qualifizierten Arbeitslosen. In der Bauelektrik lag diese so genannte Stellenüberhangsquote bei 81,7, in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bei 78,1.

- Unterwegs
Der Schlüssel zur Zufriedenheit
An einem Morgen Anfang Mai weist die Job-Suchmaschine „Stepstone“ 124 offene Stellen für die Stadt Espelkamp und einen Umkreis von zehn Kilometern aus. Es fehlen ein Projektleiter für den Automotivebereich, ein Elektroniker für den Sondermaschinenbau, eine Leiterin für die Produktionsplanung und Vertriebslogistik und 121 weitere qualifizierte Arbeitskräfte in der ostwestfälischen Stadt mit rund 25.000 Einwohnern. Laut der Studie „Hidden Champions in Nordrhein- Westfalen“ beheimatete die Wirtschaftsregion Ostwestfalen-Lippe im Jahr 2021 90 von 960 landesweit identifizierten Unternehmen dieser Art, die in der Regel zu den Top-3-Unternehmen in ihrer Branche auf dem Weltmarkt zählen. Dennoch zieht es vor allem wenige jüngere Fach- und Führungskräfte in den Nordosten von Nordrhein- Westfalen. Zu groß scheint für die meisten das Spannungsfeld von innovativen, zukunftsorientierten und gut bezahlten Jobs auf der einen, aber eher ländlichen Lebens und Versorgungsstrukturen auf der anderen Seite.

- Draufgeschaut
3 neue Kolleginnen und Kollegen
Wenn es schwieriger wird, Fachkräfte für sich zu gewinnen, lohnt sich ein genauerer Blick. Muss ich vielleicht gezielt nach neuen Gesichtern suchen, denen ich zuvor noch keine Aufmerksamkeit geschenkt habe? Wir stellen drei fiktive potenzielle Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter vor, die gewissen Zielgruppen entspringen, allerdings nicht mit ihnen identisch sind. Denn es bleibt dabei: Auch wenn ein Mensch zu einer Zielgruppe gehört, so bleibt er doch ein Individuum mit ganz eigenen Eigenschaften und Wünschen.

- Persönlich
Weshalb unsere Branche Interesse weckt
Die Mitgliedsunternehmen und -genossenschaften des VdW Rheinland Westfalen setzen sich intensiv mit innovativen Wasserlösungen im Quartier auseinander: Im Ruhrgebiet trotzen die kommunalen Wohnungsunternehmen VBW Bauen und Wohnen GmbH in Bochum und DOGEWO21 in Dortmund Starkregen und Trockenheit in ihren Wohnquartieren. Von Regenwassertanks bis hin zu grünen Dächern - diese Maßnahmen helfen nicht nur der Umwelt, sondern auch den Bewohnerinnen und Bewohnern, sorgen für ein besseres Mikroklima und wappnen das Lebensumfeld der Menschen für Extremwetterereignisse. Auch in der „Schwammstadt“ des Verbandsmitglieds VIVAWEST sind Versickerungsflächen für hohe und intensive Niederschlagsmengen ein wichtiger Teil der blauen Infrastruktur und die wassersensible Stadtentwicklung der GEBAG in Duisburg passt das Wohnen an die Gegebenheiten an, die der Klimawandel in Flussnähe am Rhein notwendig macht. In diesem Artikel heißt es: Eintauchen in nachhaltige Wasserprojekte, die Städte widerstandsfähiger, Wohnquartiere lebenswerter und das Klima vor Ort besser machen.