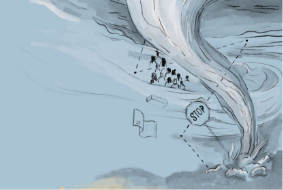Wohnungswirtschaft

- Parlamentarischer Abend
Die rheinland-pfälzische Wohnungswirtschaft im Gespräch mit der Landespolitik
Die schwierige Situation für den Wohnungsbau war Hauptgesprächsthema auf dem Parlamentarischen Abend der rheinland-pfälzischen Wohnungswirtschaft im Mainzer Landtag am 21. Februar 2024. In der Diskussionsrunde mit Dr. Stephan Weinberg, Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Finanzministerium, stellte Alexander Rychter, Verbandsdirektor des VdW Rheinland Westfalen klar: "Das Land Rheinland-Pfalz ist nicht unser Problem. Unser Problem sind die gestiegenen Zinsen und Baukosten und dass die Bundesregierung darauf keine adäquate Antwort findet." Da aufgrund gestiegener Zinsen und Baukosten der frei finanzierte Wohnungsbau kaum noch schwarze Zahlen schreibt, nutzen immmer Akteuere die Wohnraumförderung, die bisher auf diese Mittel verzichtet haben. In der Folge sind die Abrufzahlen der rheinland-pfälzischen Wohnraumförderung sprunghaft angestiegen. So wurden 2023 2.266 geförderte Mietwohnungen genehmigt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Grunde eine positive Nachricht, doch erkannte auch Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg die krisenhafte Situation als ein Grund für die Entwicklung. Mit Blick auf die Wohnraumförderbedingungen sagte er, die Landesregierung wolle hier weiterhin Kontinuität üben, er deutete aber Anpassungen an.

- Öffentliches Baurecht
Öffentliches Baurecht: Nachbarklage gegen den Neubau eines Mehrfamilienhauses
Cybersicherheit ist ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden nahezu über Nacht viele Prozesse in den digitalen Raum verlagert, sodass die EU-Kommission im Dezember 2020 als Teil ihrer Cybersicherheitsstrategie eine Reform der NIS1-Richtlinie vorschlug, die in Deutschland seit 2016 durch das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik („BSIG“) umgesetzt ist. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat eine neue Bedrohungslage ausgelöst, die den Gesetzgeber zu einer Überarbeitung der bestehenden Regulatorien veranlasst: Am 16. Januar 2023 ist die Richtlinie (EU) 2022/2555 („NIS2-Richtlinie“) in Kraft getreten. Die Mitgliedsstaaten müssen sie bis zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht umsetzen. Mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie gelten für viele Unternehmen und Organisationen verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen und Meldepflichten.

- Cybersicherheit
Wohnen als kritische Infrastruktur?
Cybersicherheit ist ein Thema, das zunehmend an Bedeutung gewinnt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden nahezu über Nacht viele Prozesse in den digitalen Raum verlagert, sodass die EU-Kommission im Dezember 2020 als Teil ihrer Cybersicherheitsstrategie eine Reform der NIS1-Richtlinie vorschlug, die in Deutschland seit 2016 durch das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik („BSIG“) umgesetzt ist. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat eine neue Bedrohungslage ausgelöst, die den Gesetzgeber zu einer Überarbeitung der bestehenden Regulatorien veranlasst: Am 16. Januar 2023 ist die Richtlinie (EU) 2022/2555 („NIS2-Richtlinie“) in Kraft getreten. Die Mitgliedsstaaten müssen sie bis zum 17. Oktober 2024 in nationales Recht umsetzen. Mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie gelten für viele Unternehmen und Organisationen verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen und Meldepflichten.

- DW-Zukunftspreis 2024
Spannende Strategien und Konzepte gesucht!
Unter dem Motto „Auf Erfolgskurs: Mehrwerte schaffen im ganzen Team“ können ab sofort Wohnungsunternehmen und -genossenschaften Konzepte, die die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft zur attraktiven Arbeitgeberin machen, als Projekte für den DW-Zukunftspreis der Immobilienwirtschaft 2024 eingereicht werden. Das Bewerbungsportal ist bis zum 31. Januar 2024 geöffnet und wartet auf spannende Strategien und Konzepten rund um gelebte Führungs- und Organisationsqualitäten. Gesucht werden Ansätze, die das Arbeiten in der sozial orientierten Wohnungswirtschaft für neue und bestehende Mitarbeitende ansprechend gestalten und Lust auf das Arbeiten in einer spannenden Branche machen.