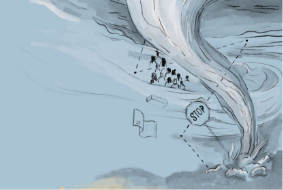Bauen
Filtern Nach
Bild
Interview
Audio
Video

- Bundespolitik
Bundesjustizministerium legt Gesetzesentwurf zum Gebäudetyp E vor
Eine Lockerung der Komfortstandards im Wohnungsbau könnte beim Kampf gegen den Wohnungsmangel helfen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gab am 11.07.2024 einen Gesetzesentwurf in die Ressortabstimmung, der genau das ermöglichen soll. Das Ziel: einfacheres und kostengünstigeres Bauen. Die Idee hinter dem Gebäudetyp-E-Gesetz Das neue Gebäudetyp-E-Gesetz soll es erlauben, bestimmte Komfort-Standards zu lockern, die für die Sicherheit eines Gebäudes nicht entscheidend sind. Beispielsweise könnten Raumhöhe, Anzahl der Steckdosen oder Norm-Innentemperaturen flexibler gehandhabt werden. Laut Buschmann könnten dadurch bis zu 10 Prozent der Baukosten eingespart werden.